Martin Luther schuf mit seiner neuen Lehre ein völlig anderes Verhältnis zwischen Staat und Kirche, zwischen Christ und Gesellschaft. Negative politische Entwicklungen der Neuzeit werden deshalb oftmals den Kirchen der Reformation zur Last gelegt. Andererseits kann man das moderne protestantische Synodalsystem als Vorbote der Demokratisierung betrachten. Die Veränderung der Verhältnisse zwischen Christen und ihrer Obrigkeit im Protestantismus kann in drei Bereichen besonders erkannt werden: im sogenannten Landesherrlichen Kirchenregiment, in der Zwei-Reiche-Lehre und in der Bewertung des gottgeweihten Lebens.
Das Landesherrliche Kirchenregiment ist eine besondere Form der Kirchenleitung, die seit der Reformation in allen protestantischen Gebieten üblich wurde. Die deutschen evangelischen Fürsten beanspruchten, gegen Luthers Hoffnung, die Kirchenleitung bald für sich selbst. Die Landesherren traten somit anstelle der entmachteten katholischen Bischöfe und übernahmen die Besoldung und Einsetzung der Pfarrer, die Festlegung der gelehrten Theologie an den Universitäten sowie die des zu folgenden Glaubens der Untertanen. Selbst nach dem Konfessionswechsel eines Landesherren zum katholischen Glauben konnte es geschehen, dass er weiterhin nominell Kirchenleiter von protestantischen Staaten blieb, die praktische Durchführung dieser Aufgabe aber einem „Konsistorium“ übertrug. Der Protestantismus verwirklichte somit all das, wogegen die Kirche im Investiturstreit leidenschaftlich ankämpfte: Die Verbindung von Kirche und Staat, die Unterwerfung der Kirche unter die Fürsten und ihre Vereinnahmung. Nachwirkungen davon sind bis heute die Konflikte zwischen der christlichen Lehre und der Mehrheitsmeinung.
In Deutschland zerbrach 1918 die Personalunion von Fürst und evangelischen Kirchenherr. Seither wird der Kirchenpräsident von den Synoden gewählt, erhält auch teilweise den Titel „Landesbischof“. Er hat aber nur wenig Leitungsvollmacht, diese haben die Synoden inne, die in der Regel zu einem Drittel aus Pfarrern und zu zwei Drittel aus Laien bestehen, welche meist keine theologische Ausbildung besitzen. Entscheidungen werden demokratisch gefällt, zu denen auch tiefgreifende Änderungen der Lehre oder Praxis gehören, so etwa die Einführung der Trauung für gleichgeschlechtliche Paare. Diese Art der Kirchenleitung kann zu einer Trift weg vom Evangelium führen und zur Meinung der Gesellschaft die Lehre Jesu könnte demokratisch entschieden und ausgelegt werden.
Für Lutheraner war die Zwei-Reiche-Lehre von großer Bedeutung. Unter Gottes Herrschaft regiert die Kirche das Reich zur Rechten, sie verkündet das Wort, spendet Sakramente, fördert Bekehrung und übt die Kirchenzucht aus. Das Reich zur Linken wird vom Staat beherrscht. Diesem Staat hat nach Kapitel 13 des Römerbriefs ein Christ zu gehorchen. Luther nahm dieses Wort sehr ernst, weshalb er sich 1525 mit gröbsten Worten gegen den Aufstand der Bauern aussprach und die Fürsten zum rücksichtslosen Durchgreifen aufforderte. So führte diese Zwei-Reiche-Lehre vor allem bei den Lutheranern zu einem weitgehend unpolitischen Christentum, was jedoch in den letzten Jahrzehnten in den Hintergrund geriet. Nun näherte man sich mehr dem katholischen Standpunkt, der ein politisches Engagement von Christen zulässt und eine bewusst vom Glauben bestimmte Einflussnahme auf die Politik anstrebt.
Auch der geistliche und weltliche Stand erhielt im Protestantismus eine andere Wertschätzung. Bis vor wenigen Jahrzehnten waren Ehelosigkeit um des Himmelreichs willen oder Ordenseintritt für den Protestantismus eine scheinbar nutzlose, unproduktive und schöpfungswidrige Lebensform. Die Reformatoren sahen die Aufgabe des Menschen darin, in seinem jeweiligen Stand der Gesellschaft zu dienen. So wurde Arbeit in der Einheit mit der Staatsideologie zu einem Gottesdienst, Produktivität zur Bürgerpflicht. Dadurch konnten sich protestantische Gebiete tatsächlich einen wirtschaftlichen und bildungsmäßigen Vorsprung vor katholischen und orthodoxen Gebieten erarbeiten. Als in der Aufklärung Klöster und Feiertage abgeschafft wurden, Wallfahrten verboten, Wochengottesdienste reduziert, blieb den Menschen mehr Zeit für die Volkswirtschaft. Auch der sparsame Bau und die Ausstattung von Gotteshäusern bewirkten einen wirtschaftlichen Aufschwung.
Die katholische Kirche unternahm in den letzten zwei Jahrhunderten große Anstrengungen den Bildungsrückstand der katholischen Völker aufzuholen, der zuvor durch die staatliche Auflösung der Klöster entstand, die ja oftmals auch Bildungsstätten waren. Ein Katholik käme aber niemals auf die Idee, wirtschaftlicher Wohlstand ist ein Zeichen für eine göttliche Auserwählung, wie es im Calvinismus oder in manchen Freikirchen vorkommen kann. Dort trifft man sogar auf ein regelrechtes „Wohlstandsevangelium“, das materiellen Wohlstand mit göttlicher Gnade verknüpfen will. Katholiken werden deshalb „systembedingt“ auch zukünftig mehr Zeit, Kraft und Geld als Protestanten in Werke der Frömmigkeit investieren, die nicht zuerst dem Nächsten oder sich selbst, sondern ausschließlich Gott und seiner Kirche dienen. Für den katholischen Glauben sind freilich auch diese Güter gut angelegt.
S.D.G.

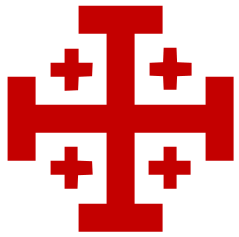
Eine Antwort auf „Protestanten und ihr Verhältnis zur politischen Obrigkeit“